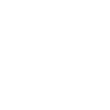Eine Beurteilung der Situation an den EU-Außengrenzen
Ein Beitrag von Brian Hagiel
I. Einleitung
Es vergeht kein Tag, an dem nicht über die Lage an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus berichtet wird. Seit Anfang Juli 2021 kommen verstärkt Asylsuchende per Flugzeug nach Belarus und versuchen von dort aus, über die Grenze in die EU zu gelangen. Die Rede ist von mehreren Tausenden Menschen. Neben Polen sind auch die baltischen Staaten Litauen und Lettland betroffen. Zu einer ersten Verschärfung der Lage kam es Anfang August 2021, als eine Gruppe von Asylsuchenden im Grenzraum nahe des polnischen Dorfes Usnarz Górny zwischen Belarus und Polen festhing. Belarussische Grenzschützer ließen sie nicht mehr ins Landesinnere zurück, polnische Grenzschützer verhinderten die Einreise nach Polen. Die Menschen harrten tagelang unter freiem Himmel in der Kälte aus, ohne ausreichende Versorgung mit Lebensmittel, ohne Wasser und ohne medizinische Hilfe. Seitdem spitzte sich die Lage immer weiter zu. Die Anzahl der Asylsuchenden an der polnischen Grenze stieg täglich an. Polen errichtete schließlich einen 2,50 Meter hohen provisorischen Grenzzaun zum östlichen Nachbarn und schickte zahlreiche Soldaten in das Grenzgebiet, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Am 2. September 2021 hat die polnische Regierung in acht Landkreisen an einem drei Kilometer breiten und 418 Kilometer langen Grenzstreifen den Ausnahmezustand ausgerufen. 1 Seitdem ist der Zutritt für Journalisten, Hilfsorganisationen und Politiker nur beschränkt oder gar nicht möglich. Eine neue Eskalationsstufe erreichte die Situation am 19. September 2021, als mehrere Menschen in der Grenzregion zu Polen mutmaßlich an Unterkühlung und Erschöpfung starben. Daraufhin soll es immer wieder zu gewaltsamen Aufeinandertreffen zwischen den Asylsuchenden und den Grenzschützern gekommen sein. Polnischen Medienberichten zu Folge soll es vereinzelt auch zu erfolgreichen Grenzdurchbrüchen gekommen sein. Die Geflüchteten seien anschließend jedoch wieder zurück nach Belarus verwiesen worden – ein Vorgehen, das auch als „Pushback“ bekannt ist und internationalem Recht widerspricht. Inzwischen hat das Verteidigungsministerium in Warschau 15.000 Soldaten an die Grenze abkommandiert, die rund 5.000 Grenzschützern und 6.000 Polizisten dabei helfen sollen, die polnisch-belarussisches Grenze zu sichern. Zudem beschloss der Sejm – das polnische Parlament – im November 2021 ein „Gesetz zum Schutz der Grenze“, das unter anderem Zutrittsbeschränkungen bereits mittels Erlass von Verordnungen ermöglicht. Auf diese Weise sollte der Anfang September verhängte Ausnahmezustand, der laut polnischer Verfassung nicht länger als drei Monate dauern darf, verlängert werden. Zuvor hatte das polnische Parlament bereits dafür gestimmt, Pushbacks zu legalisieren.
Wer nun meint, dass die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze ein einmaliges Versagen nationaler Staaten darstellt, liegt gleich doppelt falsch. Zum einen wäre es verkehrt zu denken, dass die Situation ein nationales Problem darstellt, für das es eine nationale Lösung gibt. Zum anderen ist die Situation auch nicht neu.
II. Asyl und Migration: Ein europäisches Anliegen
Die europäische Asyl- und Migrationspolitik nimmt ihren Ursprung in den Römischen Verträgen von 1957. Dort wurde das Thema zwar nicht explizit erwähnt, da zunächst wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen. Allerdings enthielten die Verträge bereits die Freizügigkeiten für Arbeitnehmer, Waren und Dienstleistungen und ermöglichten damit frühzeitig die Migration von Angehörigen der Europäischen Gemeinschaft zwischen den angehörigen Ländern. Nicht geregelt war hingegen der Zugang von Drittstaatsangehörigen. Das änderte sich jedoch in den darauffolgenden Jahren. 1985 beschloss die Europäische Gemeinschaft mit dem Schengen-Abkommen den Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der EU, wodurch die EU-Außengrenzen eine große Bedeutung erlangten. Spätestens dann wurden die Themen „Migration“ und „Asyl“ zu einem europäischen Anliegen. Zur Umsetzung des Schengener Abkommens wurde 1990 das Schengener Durchführungsübereinkommen geschaffen, auch Schengen II genannt, das 1995 in Kraft trat. In dem Übereinkommen wurden die Maßnahmen festgelegt, die die durch die Abschaffung der Binnengrenzkontrolle entstandenen Sicherheitsrisiken kompensieren und „einen einheitlichen Raum der Sicherheit und des Rechts gewährleisten“ sollten. Bei den Maßnahmen handelte es sich vor allem um einheitliche Visaregelungen für Migrant*innen und Tourist*innen aus Drittländern, Vereinbarungen zu Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen und um Absprachen zur polizeilichen Zusammenarbeit und zur Kooperation im Justizwesen. Die asylrechtlichen Bestimmungen wurden 1990 im Dubliner Übereinkommen auf den Weg gebracht, das von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde und 1997 in Kraft trat. Einer der Kernpunkte des Dubliner Übereinkommens 1990 ist das sogenannte „One-State-Only“-Prinzip, das darauf abzielt, illegale Weiterwanderungen und Mehrfachanträge auf Asyl in verschiedenen Mitgliedsstaaten zu verhindern. Zudem legte das Übereinkommen fest, dass lediglich ein Mitgliedstaat für die Prüfung eines Asylantrags sein kann und zwar der Staat, der dem jeweiligen Asylbewerbenden die Einreise gestattete.
Ein weiterer großer Schritt in Hinblick auf die migrationspolitische Zusammenarbeit innerhalb der EU erfolgte 1992 mit dem Maastrichter Vertrag, der 1993 in Kraft trat. Mit diesem Vertragswerk, das an Stelle der 1957 geschlossenen Römischen Verträge trat, wurden die Themen Migration und Asyl erstmals als „Angelegenheiten von gemeinsamen Interesse“ gehandelt. Vollständig vergemeinschaftet wurde allerdings lediglich die Visapolitik. Der Flüchtlingsschutz verblieb in der Zuständigkeit der nationalen Regierungen. Erst mit dem Vertrag von Amsterdam wurden asyl- und migrationsrechtliche Fragen und die Kontrolle der EUAußengrenzen größtenteils in die gemeinsame Zuständigkeit überführt. Auch die bereits bestehenden Schengen-Regularien wurden seitdem EU-weit angewandt. Es wurde jedoch ein „stay in/opt out“ Prinzip eingeführt, das den Staaten ermöglichte sich aus einzelnen oder auch allen Regelungen wieder zurückzuziehen.
1999 beschloss der Europäische Rat mit der Aufnahme des Programms von Tampere, dass die Umsetzung eines gemeinsamen europäischen Systems in zwei Phasen erfolgen sollte. Mit dem Beschluss des Haager Programms 2004 wurden die dem Tampere-Programm zugrundeliegenden Richtlinien weitgehend bekräftigt. Die erste Phase des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die bis 2006 andauert, sah unter anderem die Schaffung von Mindeststandards für die Aufnahme und Versorgung von Asylbewerbern, Mindestnormen für das Asylverfahren, die Dublin-II-Verordnung, die das Dubliner Übereinkommen ersetzte und die Eurodac-Verordnung zum Abgleich von Fingerabdrücken vor, die verhindern soll, dass Asylbewerber in mehreren Mitgliedstaaten Asyl beantragen. Außerdem wurde die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) geschaffen.
Die zweite, bis einschließlich 2010 währende Phase, sollte das vom Tampere-Programm und Haager-Programm angeführte europäische Asylsystem vervollständigen und ergänzen und sah schwerpunktmäßig eine Lastenteilung innerhalb der EU sowie eine engere Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur Eindämmung von Migrationsursachen vor.
Als Nachfolge des Haager Programm wurde das Stockholmer Programm für die Jahre 2010 bis 2014 aufgelegt. Es sah unter anderem vor die Visa- und Grenzsicherungspolitik weiterzuentwickeln und das Thema Einwanderung als Schwerpunkt zu behandeln. Außerdem sollte die Entwicklung des GEAS vorangetrieben werden, sowie der Aufbau eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO). Schließlich wurde auch die Dublin-III-Verordnung erlassen, die im Rahmen des GEAS 2013 an die Stelle der Dublin-II-Verordnung in Kraft getreten ist.
III. Die „Flüchtlingskrise“ 2015
Bei den zahlreichen Verordnungen, Programmen und Verträgen könnte man meinen, dass die Europäische Union auf etwaige „Migrationswellen“ gut vorbereitet gewesen war. Die „Flüchtlingskrise“ zeigte jedoch das Gegenteil. In den Jahren 2015 und 2016 sind so viele Asylbewerber*innen nach Europa gekommen wie nie zuvor. Nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat betrug 2015 die Zahl der registrierten Asylanträge 1,32 Millionen (darunter 1,26 Millionen Erstanträge) und 2016 1,26 Millionen (darunter 1,21 Millionen Erstanträge). 3 Die Asylbewerber*innen gelangten dabei vor allem über fünf große Routen nach Europa: die westliche Mittelmeeroute, die zentrale Mittelmeerroute, die östliche Mittelmeerroute, die ostafrikanische Route und die Balkanroute. Den „Auftakt der Flüchtlingskrise“ dürfte wohl ein Ereignis in der Nacht des 12. auf den 13. April 2015 gebildet haben: Ein Flüchtlingsboot kenterte vor der libyschen Küste, was vermutlich 400 Menschen in den Tod brachte.4 In der Nacht vom 18. Auf den 19. April 2015 kenterte ein weiteres Flüchtlingsschiff mit nach Augenzeugenberichten ca. 950 Menschen an Bord, von denen mehr als 700 als ertrunken galten. Noch am Tag dieser Nachricht kamen die Außen- und Innenminister zu einer gemeinsamen Ratssitzung zusammen und präsentierten einen Zehn-Punkte-Plan mit Sofortmaßnahmen zur Bewältigung der Krisensituation im Mittelmeer. Wenige Tage später kam der Europäische Rat zu einer Sondersitzung zusammen und bestätigte in seiner Erklärung weitestgehend die Ziele aus diesem Plan. Schließlich stellte die Kommission am 13. Mai 2015 eine umfangreiche „Migrationsagenda“ vor, mit der sie den migrationspolitischen Herausforderungen zu begegnen gedachte. Die Sofortmaßnahmen entsprachen im Wesentlichen den Maßnahmen des 10-Punkte-Plans. Zunächst wurde angekündigt, die gemeinsamen Mittelmeeroperationen „Triton“ und „Poseidon“ zu verstärken, indem die finanziellen und operativen Mittel aufgestockt werden und das Einsatzgebiet ausgeweitet wird. Die zweite wegweisende Entscheidung der Kommission sah vor, „einen zeitlich befristeten Verteilungsmechanismus für Personen, die eindeutig internationalen Schutz benötigen“ einzuführen, der „eine faire und ausgewogene Beteiligung aller Mitgliedstaaten an dieser gemeinsamen Anstrengung gewährleiste[n]“ sollte. Zudem nahm die Kommission auch die Neuansiedlungspläne in die Agenda auf und kündigte ein EU-weites Programm zur Übernahme von 20.000 Personen bis 2020 an und stellte für die Jahre 2015 und 2016 einen Betrag von 50 Mio Euro in Aussicht. Weitere Punkte betrafen die Bekämpfung von Schleusernetzen und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur Verhinderung der irregulären Migration. Um die besonders unter Druck stehenden EU-Mitgliedstaaten an den Außengrenzen zu unterstützen, versprach die Kommission ferner die Entwicklung eines „Brennpunkt-Konzeptes“, bei dem das EASO, Frontex und Europol vor Ort mit Mitgliedstaaten an den Außengrenzen zusammenarbeiten würden, um ankommende Migranten rasch erkennungsdienstlich zu behandeln, zu registrieren und ihre Fingerabdrücke abzunehmen. Schließlich stellte die Kommission für die EU-Außenstaaten 60 Mio. Euro Soforthilfe für ihre Aufnahme- und Versorgungskapazitäten bereit.
Zu den langfristigen Zielen gab die Kommission vier Schritte bekannt: Erstens sollten die Anreize für irreguläre Migration reduziert werden, unter anderem durch Partnerschaften mit Herkunfts- und Transitländern. Zweitens sollte ein besseres Grenzmanagement, insbesondere durch eine Stärkung von Frontex, etabliert werden, wodurch Menschenleben gerettet und Außengrenzen gesichert werden sollten. Drittens sollte die gemeinsame Asylpolitik sichergestellt werden, allen voran durch die vollständige und kohärente Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Schließlich sollte eine neue Politik für legale Migration vorgelegt werden, geprägt durch eine gut gesteuerte Visumpolitik, wirksame Integration und Maximierung der Entwicklungsvorteile in den Herkunftsländern.
IV. Die „Solidaritätskrise“
Nachdem die Erweiterung der Seenotrettung, die Einrichtung der Hotspots und die Pläne zur Umsiedelung und Neuansiedlung als konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, schlug die Kommission am 9. September 2017 eine Erweiterung des Umsiedlungsmechanismus vor. Zu den ursprünglich festgelegten 40.000 sollten weitere 120.000 Menschen umgesiedelt werden, was explizit eine Reaktion auf die erneut angestiegenen Antragszahlen von Juli und August 2017 war. Die ungarische Regierung weigerte sich jedoch mit der mandatorischen Übernahme von Kontingenten aus dem Erweiterungsbeschluss. Die Slowakei, Rumänien und die Tschechische Republik unterstützten diese Opposition und votierten ebenfalls gegen den Ratsbeschluss. Die Stimmen der Opposition reichten jedoch nicht für eine Sperrminorität aus, sodass der Ratsbeschluss verabschiedet wurde. Das führte allerdings zu heftigen politischen und rechtlichen Auseinandersetzungen, die bis heute nachwirken und die Grundlage für die europäische Solidaritätskrise bilden. Ungarn und die Slowakei gingen sogar so weit, dass sie am 2. und 3. Dezember 2015 vor dem EuGH gegen den Ratsbeschluss klagten. Am 6. September 2017 wies der EuGH die Klage in allen Punkten ab und begründete die Entscheidung damit, dass der Rat verpflichtet gewesen sei, Art. 80 AEUV anzuwenden, da dieser für alle Maßnahmen in der Asylpolitik gelte. Ferner stellte der EuGH klar, dass wenn sich Mitgliedstaaten in einer Notlage befinden, die von Art. 78 Abs. 3 AEUV abgedeckt ist,
„die Belastungen, die mit den aufgrund dieser Vorschrift zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten erlassenen vorläufigen Maßnahmen verbunden sind, grundsätzlich auf alle anderen Mitgliedstaaten aufgeteilt werden [müssen], im Einklang mit dem Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, der nach Art. 80 AEUV für die Politik der Union im Asylbereich gilt.“
Der Generalanwalt Yves Bot ging in seiner Einschätzung sogar einen Schrift weiter und argumentierte, dass das Handeln Ungarns und der Slowakei gegen „die Pflicht zur Solidarität und zur gerechten Aufteilung der Lasten“ verstoße. Während die slowakische Regierung das Urteil widerstrebend akzeptierte, regierte die ungarische Regierung ungehalten und kündigte an, auch weiterhin keine Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Die im November 2015 an die Regierung gekommene rechtsnationale polnische PiS-Partei schloss sich dieser Ankündigung an und unterstütze die Klagen Ungarns und der Slowakei gegen den Ratsbeschluss. Die EUKommission erhob deshalb im Dezember 2017 drei Vertragsverletzungsklagen bei EuGH. Am 02.04.2020 befand der EuGH, dass die Mitgliedstaaten nach den angegriffenen Beschlüssen zwar die Aufnahme von konkreten Personen verweigern können, wenn sie „objektive und eindeutige Indizien, die den Verdacht stützen, dass der betreffende Antragsteller eine solche gegenwärtige oder potenzielle Gefahr darstellt.“ Sie könnten die Aufnahme von Flüchtlingen jedoch nicht generell aufgrund bloßer Befürchtungen und aus Gründen der Generalprävention ablehnen. So lobenswert das Urteil sein mag, es dürfte wohl nur deklaratorischer Natur sein. Da das Umverteilungsprogramm von 2015 nicht mehr in Kraft ist, dürften sich drei Staaten von dem Urteil jedenfalls nicht sonderlich beeindruckt zeigen.
V. Das EU-Asyl- und Migrationspaket – die Lösung?
Am 23.09.2020 legte die Europäische Kommission den seit langem angekündigten „New Pact on Migration“ als einen „Neuanfang in der europäischem Migrationspolitik“ vor. Nach intensive Beratungen mit sämtlichen Mitgliedsstaaten sowie dem 2019 neu gewählten Europäischen Parlament sollte der Vorschlag der Kommission das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten wiederherstellen und eine verlässliche faire Balance zwischen Verantwortlichkeit und Solidarität enthalten, um die gegenwärtigen ad-hoc Lösungen durch ein echtes und effizientes Migrationsmanagement zu ersetzen. Ein zentraler Aspekt des beinahe 340 Seiten umfassenden „New Pacts“ ist ein neuer verpflichtender „Solidaritätsmechanismus“ Dieser kann von einem Mitgliedstaat, der migrationspolitischen Druck verspürt, oder von der Kommission eingeleitet werden. Basierend auf den Erfordernissen des unter migrationspolitischen Druck geratenen Mitgliedstaates, sollen die EU-Mitgliedstaaten konkrete „Solidaritätspläne“ vorlegen, die eine Umverteilung von Asylsuchenden (von EU-Grenzstaaten), das Abschieben von irregulären Migrant*innen (aus diesen EU-Grenzstaaten) oder andere operationelle Maßnahmen betreffen, um die Herausforderungen zu bewältigen. Für den Fall, dass vorgelegten Pläne nicht ausreichen, um für den betroffenen Staat Abhilfe zu schaffen, würde ein „Korrekturmechanismus anhand der kritischen Masse“ greifen, der vorsieht, dass die Mitgliedstaaten zumindest 50 Prozent der von der Kommission vorgesehenen Umverteilungen oder „Rückführungen“ umsetzen. Im Prinzip heißt das: Wer keine Menschen aufnehmen will, soll bei der Abschiebung unterstützen. Schaut man sich die derzeitige Lage an der EU-Außengrenze an, wird deutlich, dass bei dem Pakt seit seiner Einführung keine wesentlichen Fortschritte zu verzeichnen sind. Vielmehr scheint eine europäische Einigung in weiter Ferne. Während einige Mitgliedstaaten in Sachen Flucht und Migration unabhängig bleiben wollen, streben andere eine gesamteuropäische Lösung an. Das Resultat dieser Diskrepanz besteht darin, dass einige EU-Außenstaaten aktuell offen und strategisch Gesetze brechen, um die Einreise von Migrant*innen zu verhindern, während die EU beide Augen verschließt. Man muss sich daher die Frage stellen, ob es eine dauerhafte gesamteuropäische Lösung in Sachen Asylpolitik überhaupt gibt. Sollte das nicht der Fall sein, müsste man das Projekt EU insgesamt in Frage stellen. Schließlich ist Solidarität unter den Mitgliedsstaaten ein zentraler Wert der EU und das Herzstück des Integrationsprozesses. Findet sich dagegen doch eine Lösung, könnte die EU beweisen, dass sie mehr als nur die Summe ihrer Interessen ist und damit gestärkt aus der Krise hervorkommen.