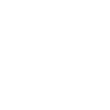Unser Landesvorsitzender in den Europa-Nachrichten des BBE
Erschienen im "Newsletter für Engagement und Partizipation in Europa", Ausgabe 11/2021, des Bundesnetzwerk Bürgerliches Engagement..
Die Digitalisierung gilt als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie betrifft dies auch das Ehren- und Hauptamt in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Es dauerte nicht lang bis Videokonferenzen physische Treffen ersetzten: Gremiensitzungen wie auch Veranstaltungen wurden nicht über Nacht, aber doch in recht kurzer Zeit auf Online-Formate umgestellt.
Digitalkompetenz
Allerdings: auch in Deutschland wird der »digital divide« deutlich. Während hierzulande bei der Altersgruppe der bis zu 60Jährigen nahezu alle über einen Internetzugang verfügen, gelten erst die Altersgruppen jenseits der 75 Jährigen als eindeutig digital »abgehängt«. Nicht übersehen werden sollte dabei, dass der bloße Zugang zum Internet notwendiges, aber nicht hinreichendes Merkmal dafür ist, ob digitale Partizipationsmöglichkeiten ausgeschöpft werden können.
Der Blick über den Tellerrand: West- und Nordeuropa stehen sowohl bei der Ausstattung als auch beim Zugang zum Internet relativ gut dar. In den meisten Ländern Süd- und Osteuropas haben nach Zahlen der Europäischen Investitionsbank weniger als die Hälfte der Menschen einen Computer; in 10 von 27 EU-Staaten nutzen rund ein Viertel grundsätzlich keine E-Mails, die – obwohl dieses Medium schon oft totgesagt wurde – immer noch eine der zentralen Basistechnologien digitaler Kommunikation sind.
Laut »Special Eurobarometer 503« (2020) der EU Kommission halten sich nur 28% der Europäer für ausreichend kompetent, um digitale Technologien zu nutzen, 40% halten sich mit Einschränkungen kompetent, und ein Drittel traut sich selbst keine ausreichende Kompetenz zu. Zahlreiche Statistiken zeigen klar, dass mit niedrigerem sozioökonomischem Status und geringerer formaler Bildung die Zugangshürden (deutlich) steigen. Ein Breitbandanschluss und ein Netflix-Konto tragen in vielen Statistiken bereits zur positiven Digitalisierungsbilanz bei. Ein Ausdruck von »digitalem Empowerment« ist dies nicht.
So wichtig Diskussionen über den Breitbandausbau oder Tablets für alle Schüler/innen sind: Die Mehrheit der Europäer/innen hat die Schule verlassen und die reale Partizipationshürde ist oft seltener die Bandbreite als fehlende Kompetenzen. Schule und Glasfaser werden deshalb nicht die Antwort auf die Fragen bieten, wie wir jetzt und in naher Zukunft mehr Menschen befähigen, sich auch auf digitalem Wege einzubringen. Politik, Arbeitgeber aber auch zivilgesellschaftliche Akteure sind in der Pflicht, die Lücke zu füllen und dabei zu helfen, mehr Menschen zu befähigen, den gesellschaftlichen Wandel, den der Medienwandel bringt, zu nutzen, anstatt durch ihn abgehängt zu werden.
Bezüglich der Infrastruktur passieren immer wieder Fehleinschätzungen, die auf der Annahme beruhen, dass es nur an Infrastruktur mangele. Ein aktuelles und trauriges Beispiel ist die digitale Plattform zur Konferenz zur Zukunft Europas. Die naive Erwartung, die Plattform würde schon genutzt werden, erfüllte sich nicht und die Nutzungszahlen zeigen wie wenig realitätsnah die Einschätzungen bezüglich des Interesses, aber möglicherweise auch der »digital literacy« von Europas Bürger/innen waren. Die Plattform wurde kaum genutzt und wenn, dann primär von formal hochgebildeten Bürger/innen. Insgesamt ist sie ein klarer Fall von »Technik sucht Anwendung«. Sie stellt ein Beispiel für eine Infrastruktur dar, für die es keinen echten Bedarf gibt.
Digitale Infrastruktur
Allerdings: Über sinnvolle Investitionen in Infrastruktur, die Partizipation ermöglichen, sollte mehr diskutiert werden. Statt teure Investitionen in Plattformen, für die es nachweislich keinen Bedarf gibt, reichen mitunter schon vergleichsweise geringe Investitionen, um in der Breite wirksam zu werden.
Dass auch kleinere oder weniger finanzkräftige zivilgesellschaftliche Akteure relativ schnell nach Beginn der Pandemie in der Lage waren, auf digitale Formate umzustellen, ist vor allem einem Umstand zu verdanken: Nämlich dem, dass große US-Konzerne kostengünstige Angebote machten oder freie Open Source-Software genutzt werden konnte. Die Marke zoom mag mittlerweile, trotz zahlreicher Sicherheitsprobleme, als der Inbegriff für Videokonferenzen gelten und Google Drive als eine der bekanntesten Systeme zur Dokumentenablage. Als erste Adresse für Vereine sind sie eher nicht zu empfehlen. In einer neuen Open Source-Strategie liegen größere Potenziale; sowohl für eine Stärkung der Zivilgesellschaft als auch für die EU allgemein, die mit einer Open Source-Strategie die Chance hätte, sich aus der Hegemonie der großen US-Konzerne und »Hyperscaler« zu befreien.
Die EU-Kommission legte im September dieses Jahres eine beachtenswerte Studie vor, in der sie feststellte, dass Open Source im Jahr 2018 zwischen 65 und 95 Milliarden Euro zur EU-Wertschöpfung beigetragen habe. Ferner stellte die Kommission fest, dass Open Source einen wichtigen Beitrag für den öffentlichen Sektor leiste und leisten könne, um Kosten zu reduzieren.
Auch für Verbände liegen Entwicklungschancen in der verstärkten (öffentlichen) Förderung von Open Source, da sie Kosten senken helfen und Autonomie stärken. Ich möchte dies mit einem Beispiel aus der Mikroperspektive aufzeigen. Wie viele Organisationen setzen auch wir in unserem Verband auf Open Source-Software. Nicht nur, aber auch aus Kostengründen. Für die digitale Zusammenarbeit nutzen wir schon seit Jahren die Open-Source-Software Nextcloud und führten BigBlueButton kurz nach Beginn der Pandemie als Konferenzsystem ein. Wir profitierten von den Chancen, die Open Source bietet, wie an einem einfachen Beispiel zu zeigen ist: Klaus Herberth, ein Entwickler und aktives Mitglied in einem Rote Kreuz Ortsverband, schrieb in kürzester Zeit eine Software, die beide Systeme integrierte; der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) übernahm sie und finanzierte eine kleine, aber praktische Weiterentwicklung, die das Rechtemangement deutlich vereinfachte; und wir profitierten, wie viele andere auch, weil die Früchte dieser Investition geteilt wurden und die Verwaltung dieser Systeme dadurch sehr schnell sehr einfach wurde.
Diese kleine Geschichte zeigt, was mit proprietären Lösungen grundsätzlich nicht möglich gewesen wäre: erst durch die Offenheit des Quellcodes bzw. der Schnittstellen entstand die Möglichkeit für Herberth autonom eine solche Integration zu einer Software seiner Wahl zu schreiben und für uns – am Ende der Kette – von der Investition des DBJR zu profitieren, ohne dass wir selbst hierfür Mittel im Haushalt haben freimachen müssen. Die Rückgabe dieser Investition an die Allgemeinheit durch Herberth und den DBJR führte so zu einer Stärkung weiterer zivilgesellschaftlicher Organisationen. Sie stellt somit ein gutes Beispiel dafür dar, wie digitale Infrastrukturentwicklung so gestaltet werden kann, dass zivilgesellschaftliche Organisationen in der Breite gestärkt werden. Dies gilt insbesondere auch für kleinere oder weniger finanzstarke Organisationen; auch außerhalb Deutschlands, wo es für zivilgesellschaftliche Akteure oftmals sehr viel schwieriger ist, von nationalen staatlichen Stellen institutionelle oder projektgebundene Förderungen zu erlangen. Aus meiner Sicht wäre es deshalb erfreulich, wenn Verbände dem guten Beispiel des DBJR folgen würden.
Für eine nachhaltige Entwicklung wäre es aber noch wichtiger, dass es nicht nur hier und dort Projektmittel für neue Funktionen gibt, sondern eine nachhaltige Finanzierung, die regelmäßige Fehlerkorrekturen, Behebungen von Sicherheitsproblemen und Ähnlichem sicherstellte. Kontinuierliches Engagement großer Verbände und insbesondere staatlicher Stellen würde helfen, sichere und aktuelle Software auch für kleinere zivilgesellschaftliche Organisationen dauerhaft verfügbar zu machen. Es ist zu hoffen, dass fortgesetzte Investitionen zum Beispiel des Innenministeriums in die »Bundescloud« oder Dienste wie »bwSync&Share« des Karlsruher Institut für Technologie für die Hochschulen des Landes Baden-Württemberg zur Fortentwicklung der auch durch den DBJR, uns und anderen Verbänden genutzten Technologie beiträgt. Denn derartige staatliche Aufwendungen tragen nicht zum Umsatz amerikanischer Großunternehmen bei, sehr wohl aber zur gemeinwohlorientierten Arbeit zahlreicher NGO’s, die auf Open Source setzen und so mehr von ihren Budgets für ihre eigentlichen Kernaufgaben einsetzen können.
Die Bundesrepublik und die Europäische Union sollten Open Source stärker fördern. Der Grundsatz »public money, public code«, für den die Free Software Foundation Europe seit Jahren wirbt, ist deshalb eine gute Richtschnur. Software, die mit Steuergeldern finanziert wird, sollte möglichst als freie Software veröffentlicht werden. Dies würde indirekt in vielen Fällen auch zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft führen, da Kosten gesenkt und Autonomie gestärkt würde.
Zugang zu Informationen
Bei der Betrachtung des Digitalisierungsthemas aus der Perspektive der europäischen Zivilgesellschaft sollten »Open Access« und »Open Data« nicht unerwähnt bleiben. Denn auch hier gibt es Chancen.
Während in den Naturwissenschaften Open Access mittlerweile relativ verbreitet ist, gilt dieses für die Felder, die sich mit europäischer Integration oder Forschung zu EU-Themen beschäftigen nur sehr bedingt. Multiplikatoren und Meinungsführer, die die Universität verlassen haben, erhalten entweder nur sehr umständlich Zugang zu aktuellen wissenschaftlichen Publikationen oder müssen den Zugang oftmals sehr teuer bezahlen. Das mag Spezialisten erfreuen, deren Marktwert steigt, weil sie häufiger eingeladen werden, um Entwicklungen zu kommentieren oder zu erklären. Aber es erschwert Diskurse z.B. in fachlichen Arbeitsgruppen von Verbänden, weil Papiere und Analysen nicht frei zirkulieren und so zur fundierten Meinungsbildung beitragen können. Öffentlich finanzierte Forschung könnte im politischen Vorfeld zur besseren und fundierteren Meinungsbildung beitragen, wenn ihre Ergebnisse breiter publiziert würden.
Etwas besser sieht es bei Open Data aus. Gerade die EU, aber auch das Statistische Bundesamt, stellen mittlerweile zahlreiche statistische Daten über offene Schnittstellen zur Verfügung, die Vereine für ihre Arbeit nutzen können. Sei es als Basis für ihre politische Arbeit als auch zur Organisationsentwicklung, etwa weil Mitgliederdaten vor dem Hintergrund demographischer Daten analysiert werden können.
Hierbei sind die fachlichen Hürden allerdings relativ groß, und sie werden auf absehbare Zeit relativ groß bleiben, so dass dieses Potenzial nur von Organisationen zu nutzen sein wird, die im Haupt- oder Ehrenamt Akteure haben, die eine hinreichende Kompetenz besitzen.
Vereine brauchen »CTO’s«
Damit komme ich zum letzten Punkt: zivilgesellschaftliche Organisationen, die die Chancen der Digitalisierung nutzen wollen, brauchen sowohl auf der Arbeitsebene als auch in der Führung möglichst hohe fachliche Kompetenz. Wichtige Ressourcenentscheidungen werden durch Organisationsspitzen getroffen. Fehlen Akteure, die ein breites Wissen und Verständnis für Digitalisierungsthemen haben, oder werden diese nicht gehört, bleiben Investitionen aus oder es werden mit höherer Wahrscheinlichkeit Fehlinvestitionen getätigt, mit der Folge, dass Chancen, aus Angst vor weiteren Fehlinvestitionen, nicht genutzt werden. Ein vicious circle, den es zu vermeiden gilt.
Digitaltechnologien werden auch innerhalb vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen zu einem Zukunftsfaktor. Vereine täten deshalb gut daran, neben dem traditionellen Amt eines Finanzvorstands, auch einen Technikvorstand einzuführen und/oder – bei Verbänden mit hinreichender Finanzausstattung – eine hauptamtliche Stabsstelle zu schaffen.